Baugipfel in Berlin – Rückschritt für Klima, Natur und Mensch
Am 25.09.2023 fand in Berlin der sogenannte Baugipfel statt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesbauministerin Klara Geywitz luden die Mitglieder des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum ins Bundeskanzleramt ein. Aber statt die dringenden Weichen für Klima- und Naturschutz zu stellen, wurde ein Wohlfühlpaket für die Bau- und Immobilienbranche vorgelegt. Das kritisieren wir scharf.
Lösung für neuen Wohnraum liegt im Bestand
Wenn wir zugleich neuen Wohnraum schaffen und ernsthaft Klima- und Umweltschutz betreiben wollen, kann der Fokus nur auf dem Gebäudebestand liegen. Die überholte Praxis, massenhaft neue Baugebiete und dazugehörige Infrastrukturen auszuweisen, geht auf Kosten wertvoller Flächen für Klima- und Biotopschutz und für Zwecke der Forst- und Landwirtschaft. Aktuell gehen in Deutschland etwa 55 Hektar Freifläche pro Tag verloren, weil sie für Siedlungs- und Verkehrsflächen in Anspruch genommen werden. Die Anerkennung unbebauten Bodens als begrenzte und nicht wiederherstellbare Ressource legt nahe, dass wir uns dringend zu einer Bodenkreislaufwirtschaft hin entwickeln müssen, also einem faktischen Netto-Null-Verbrauch.
Hinzu kommt der Ressourcenverbrauch neuer Baugebiete. Nicht nur die Neubauten selbst binden enorme Mengen an Ressourcen. Eine vergleichbare Menge wird für die notwendigen Infrastruktur- und Umfeldmaßnahmen zulasten der Gesellschaft verbraucht. Insofern ist die Initiative der Bundesregierung, leerstehenden Gewerbebestand zu Wohnraum umzunutzen, zu begrüßen. Die Maßnahme greift jedoch viel zu kurz.
Schon 2019 hat die Technische Universität Darmstadt in einer Studie festgestellt, dass allein durch Umnutzungen und Aufstockungen 2,3 bis 2,7 Mio. Wohnungen geschaffen werden könnten – ganz ohne dafür neue Baugebiete ausweisen zu müssen! Der geplante genehmigungsfreie Dachausbau ist ein guter erster Schritt auf diesem Weg, aber längst nicht ausreichend. Wir sollten die Wohnungsknappheit nach dem Konzept der dreifachen Innenentwicklung, wie sie das Umweltbundesamt vorschlägt, anstatt durch folgenschweren Flächenverbrauch lösen.
Wenig genutzt werden bislang auch die Potenziale, die sich aus organisierten Umzugshilfen ergeben könnten. Es ist nicht einzusehen, dass Personen, die zum Beispiel nach Auszug der Kinder in eine kleinere Wohnung umziehen möchten, nach dem Umzug wegen des neuen Vertrags oft mehr Miete zahlen müssen als zuvor. Das müssen wir ändern. Vor allem in Ballungsgebieten ist Leerstand zu Spekulationszwecken ein großes Problem. So ließen sich durch Umzugsmanagement und Spekulationsverbot ganz ohne Bautätigkeit mehrere Hunderttausend Wohnungen schaffen.
Der Bestand muss dringend energetisch ertüchtigt werden. Ein Drittel der Gebäude fällt in die schlechtesten Effizienzklassen. Diese Gebäude als erste zu sanieren, wäre der wirksamste Hebel, um den Klimaschutz im Gebäudesektor voranzubringen und gleichzeitig soziale Härtefälle zu vermeiden. Durch die graue Energie, die in einem bestehenden Gebäude steckt, ist eine Modernisierung (fast) immer ökologisch effizienter als abzureißen und neu zubauen. Daher setzen wir uns für ein Abrissmoratorium ein.
Die wichtigsten Potenziale liegen also in den Städten, Siedlungen und Häusern, die schon da sind. Diese besser und intensiver zu nutzen, Gebäude ggf. zu erweitern und energetisch zu ertüchtigen, kann den dringend erforderlichen Wohnraum schaffen, Flächenfraß verhindern, Ressourcen schonen und Städte und Siedlungen lebenswerter machen.
Mehr Gemeinwohl, weniger Spekulation
Zu begrüßen sind mehr Förderungen für den sozialen Wohnungsbau und die Initiative zu einer neuen Wohngemeinnützigkeit. Diese Ausrichtung muss jedoch noch viel weiter gehen. Dass Fördergelder auch an große börsennotierte Konzerne der Immobilienwirtschaft gehen, bedeutet, dass ein Teil der Steuergelder letztlich in die Rendite der Aktionär*innen fließt, anstatt in Schaffung von Wohnraum und Umwelt- und Klimaschutz. Das muss aufhören.
Eine stärkere Ausrichtung auf an Gemeinnützigkeit orientierter Wohnraumschaffung hat außerdem den Vorteil, dass hierbei in der Regel sorgsam mit den Wohnflächen umgegangen wird. Die Wohnfläche pro Kopf nimmt in Deutschland stetig zu. Aktuell liegt sie bei über 47 Quadratmetern – Tendenz weiter steigend. Eine Entwicklung, die viele Bemühungen um mehr Energieeffizienz zunichtemacht – der vielzitierte Rebound Effekt. Wir brauchen statt immer mehr Wohnfläche pro Kopf vor allem gute Wohnqualitäten für alle – eine größere Wohnung ist nicht unbedingt eine bessere.
Neubau nur noch in Ausnahmefällen und dann zukunftsfähig
Für zwingend erforderliche Neu- und Erweiterungsbauten sollte der bereits beschlossene Effizienzhaus-40-Standard verbindlich gelten. Diesen nun auszusetzen bedeutet, dass wir heute mit viel Geld und Ressourcen Gebäude bauen, die bei ihrer Fertigstellung technisch bereits veraltet sind. Die Mehrkosten für den zeitgemäßen energetischen Standard sind verglichen mit den sonstigen Baukosten gering. Statt einen zukunftsfähigen Neubau zu fordern, will die Ampel jedoch die Problemfälle von morgen bauen lassen – auf Kosten des Klimas, der Natur und der Menschen.
- Baugipfel in Berlin – Rückschritt für Klima, Natur und Mensch - 10. Oktober 2023
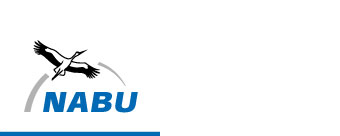


 Verfolgen Sie die Reise unserer Senderstörche!
Verfolgen Sie die Reise unserer Senderstörche! 
9 Kommentare
Felix
31.01.2024, 14:22Es scheint mir, dass der Schlüssel zur Lösung der Wohnraumproblematik in der effizienteren Nutzung des Bestands liegt, wie der Artikel aufzeigt. Allerdings frage ich mich, ob wir nicht auch innovative Technologien wie Abscheideranlagen stärker in den Fokus rücken sollten, gerade im Hinblick auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die Bedeutung solcher Technologien für die Bauindustrie wird oft unterschätzt, obwohl sie eine wesentliche Rolle in der Abfallwirtschaft und beim Ressourcenschutz spielen. Könnte es nicht sein, dass die Kombination aus Bestandsoptimierung und moderner Umwelttechnik die effektivste Lösung darstellt?
AntwortenUwe
10.12.2023, 21:37Gibt es denn eigentlich überhaupt schon ein erfolgreiches Beispiel von umgewidmeten Wohnraum, also von Büro zu Wohnungen? Ich frage mich das, weil zum Beispiel im Raum Frankfurt/Main in den letzten Jahren und aktuell extrem viele Bürogebäude gebaut werden, die jedoch aufgrund von Homeoffice und zu hohen Büromieten zu großen Teilen leer stehen. Zitat: "Jedes elfte Büro in Frankfurt steht leer" (https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/in-frankfurt-stehen-eine-million-quadratmeter-bueroflaeche-leer-19007199.html).
AntwortenChristoph Schnitzler
02.12.2023, 11:16Hallo, zum Thema Wohnungsbau lässt sich sagen, das wenn weiterhin 2 Millionen angebliche Fachkräfte nach Deutschland einwandern, der Wohnungsmangel weiterhin zunehmen wird, dies möchten vor allem die Grünen. Die Bundesregierung selbst hat die Zeit billigen Geldes verschlafen, eine Nullzinsspolitik hätte man besser nutzen können Wohnraum zu schaffen. Der von Frau Geywitz geforderte Quadratmeterpreis von 6 Eu pro qm bei Vermietung nach Neubau ist unrealistisch, erst recht bei erhöhten bautechnischen Auflagen und Vorschriften. Für private Vermieter muss es steuerliche Anreize geben in Wohnraum zu investieren, institutionelle Anleger wie z.B. die Versicherungswirtschaft verfügt jährlich über ein Anlagevolumen von 300 Milliarden, welches heute nicht mehr in Wohnraum investiert wird, viel zu mieterfreundlich ist das Mietrecht, immer neue Auflagen,überall Mietnomaden und Ärger ohne Ende mit frechen und dreisten Mietern, davon kann ich als privater Vermieter ein Bich schreiben, das können Sie glauben, sog geht es nicht weiter in dieser Miternation. In Ostdeutschland wird weiterhin Wohnraum abgerissen statt dort Asylanten einzuquartieren, ebenfalls unverantwortlich. Für Luxuswohnngen sollte es verschäfrte Bauvorschriften geben, diese Klientel kann sich das leisten, auch der Staat selbst sollte mit gutem Beispiel vorangehen und seine stadteigenen Immobilien, Schulen und Behörden ersteinmal selbst energetisch ertüchtigen, der Bund, die Beamten und Behörden haben mehr Zeit, Ressourcen und Kompetenzen frei Massnahmen umzusetzen und zu erforschen was an effizienten Massnahmen durchgeführt werden sollte. Die Bundeszentrale der Grünen ist energetsich nicht ertüchtigt wie auch die Villen und Häuser von grünen Ministern und Abgeordneten wie z.B. Habeck und Baerbock, die im Luxus leben können. Erst dann sollte man den im scharfen internationelen Wettbewerb stehenden Unternehmen Auflagen machen und mit den Ergebnissen der Staatsgebäude versorgen, denn auch bei den Dämmmassnahmen ist bereits mit neuen erheblichen Bausünden zu rechnen, einige müssen ihre Dämmungen bereits wieder abreissen und teuer als Sondermüll entsorgen. Auch ist die Frage wie üblich nicht ansatzweise geklärt wer die gewaltigen Kosten dafür übernehmen soll während andere länder wie China und Russland nichts für Umwelt- und Naturschutz unternehmen aber unsere ausgelagerten jobs z.B. aus der Motoren- und Fahrzeugindustrie einfach übernehmen und einfach weiterproduzieren. Auch hier geht es so mit Sicherheit nicht weiter, nur globale Lösungen machen Sinn, alles andere ist und bleibt ansonsten Unsinn und zerstört den Wirtschaftsstandort Deutschland von dem wir alle noch gut leben können, wer weiss wie lange noch!
AntwortenRalf Herweg
02.11.2023, 22:52"Die wichtigsten Potenziale liegen also in den Städten, Siedlungen und Häusern, die schon da sind." Korrekt- der Gebäudesektor ist auch einer der größten CO2 Produzenten. Die Energieversorgung hinkt hier für größere Anlagen und kleine Mehrfamilienhäuser stark hinterher. Es gibt ein paar Firmen die sich dieser Problematik bewusst sind, mein Favorit ist ein Start-Up aus München: https://pionierkraft.de/2023/06/01/case-study-mieterstrom-erfahrung-mit-andreas-schneider-pionierkraft-nachhaltige-rentabilitaet-%e2%9a%a1%f0%9f%92%9a%f0%9f%8f%a2/ Der Artikel hat mir sehr gut gefallen. LG Ralf Herweg
AntwortenKlaus Koziolek
12.10.2023, 16:42Ich habe 40 Jahre in bezirklichen Naturschutz- und Bauverwaltungen gearbeitet und habe daher leider sehr viele üble Erfahrungen mit den gesetzlichen Vorschriften und ihren Umsetzungen gemacht. Hier aber nur etwas zum Thema Dachausbau: Es stimmt nicht, dass der Dachausbau flächensparend ist! Wegen des Brandschutzes in größerer Höhe müssen bei mehrgeschossigen Häusern Feuerwehrumfahrten angelegt werden, die einen Großteil des vorhandenen Wohngrüns vernichten und mehr Flächen beanspruchen, als durch die Dachausbauten als Wohnflächen gewonnen werden. Es werden mehr Parkplätze und Müllplätze benötigt, auch Leitungen müssen verstärkt oder neu verlegt werden. Dies geschieht alles ausnahmslos in den wohnungsnahen Grünflächen mit vielen Baumfällungen. Diese Flächen gelten dann in der Bauleitplanung weiterhin als Frei- und Grünflächen, sind aber einer Wiederbegrünung dauerhaft entzogen! Ich musste dies alles zähneknirschend genehmigen, weil Baugesetze bis heute den Naturschutzvorschriften übergeordnet sind, und musste mir natürlich Vorwürfe aus der Bevölkerung anhören, wie ich dieses so genehmigen konnte! Ich halte es für wichtig, dass der NABU als (auch meiner Meinung nach) kompetenter Naturschutzverband diese Zusammenhänge erkennt und publiziert, da sonst problematische, aber politisch und ökonomisch gewollte Vorhaben als umweltgerecht ausgegeben werden.
AntwortenBruno Röver
13.10.2023, 13:34Sehr geehrter Klaus Koziolek, vielen Dank für die sachlichen Hinweise und die Einblicke in Ihre Berufserfahrung! Sie haben natürlich recht, dass man auch bei Aufstockungen, Dachausbauten und anderen Arten der Nachverdichtung genau hinschauen muss. In meiner eigenen beruflichen Praxis sind mir überwiegend Projekte begegnet, bei denen keine zusätzlichen Flächen für die Feuerwehr erforderlich waren (unveränderte Gebäudeklasse, bereits im Bestand ausreichende Flächen für Aufstellung, Bewegung, Rettung und Löschangriff, etc.). Im Maßnahmenpaket der Bundesregierung ist vorgesehen, dass bei Aufstockungen und Erweiterungen im Bestand keine zusätzlichen Stellplatzpflichten entstehen. Das begrüßen wir als NABU aus den von Ihnen genannten Gründen ausdrücklich. Unseres Erachtens liegt in einer intensiveren Nutzung des Siedlungsbestands durchaus ein großes Potential, um den Bedarf an deutlich ressourcen- und flächenverbrauchenderen Neubaugebieten drastisch zu reduzieren - insbesondere auch, weil im Bestand Infrastrukturen wie Erschließungsstraßen bereits gebaut sind. Dennoch: ihr Hinweis ist richtig und wertvoll und zeigt einmal mehr, dass bei der Bauwende jeder Einzelfall klug und mit Sachverstand betrachtet werden muss. Zu einer Zerstörung wohnungsnaher Grünräume, die Sie zu recht beklagen, darf es nicht kommen! Eine übergeordnete Empfehlung, deren Ausrichtung wir teilen, bietet hierzu das vom Umweltbundesamt erarbeitete Leitbild der dreifachen Innenentwicklung. Hier ist ausdrücklich die weitere quantitative und qualitative Entwicklung (nicht die Reduzierung!) von Grünräumen innerhalb der Siedlungsflächen Teil der Strategie.
AntwortenFelix
12.10.2023, 09:10Schwieriges Thema, wie ich finde. Es gibt bereits jetzt massiven Wohnraummangel und es wird noch schlimmer. Dabei muss man wirklich darauf achten, dass der Klimaschutz nicht zu kurz kommt! Schöner Beitrag, weiter machen :)
AntwortenBruno Röver
13.10.2023, 13:37Vielen Dank für das positive Feedback und Ihren Hinweis.
Antworten