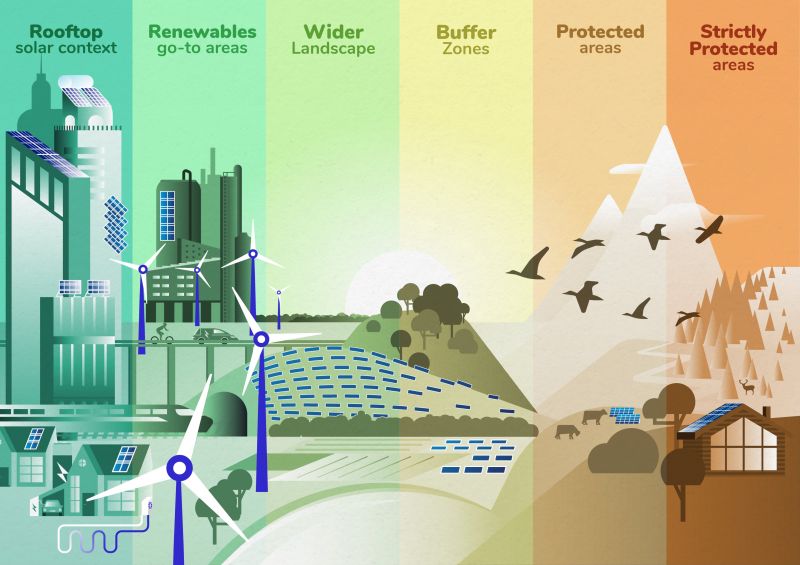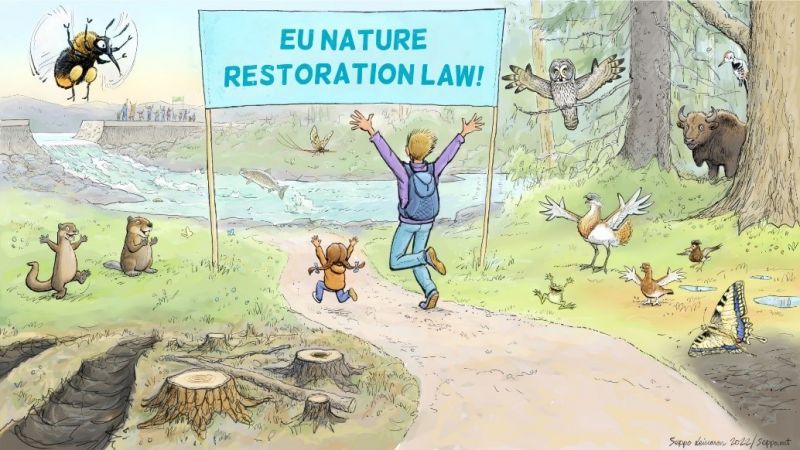Nature Restoration Law: Update aus Brüssel

Europaparlament, Straßburg. Foto: Udo Pohlmann, Pixabay
NABU-Forderungen, politischer Trilog und intensive technische Arbeit
Liebe #RestoreNature Freundinnen und Freunde,
dieser Beitrag liefert ein kurzes Update aus Brüssel zu dem vor der Sommerpause heftig attackierten Nature Restoration Law (siehe hierzu auch meinen letzten Beitrag zur Abstimmung des Europäischen Parlaments). Denn auch wenn es noch zu früh ist für konkrete Ergebnisse: die Verhandlerinnen und Verhandler der drei am Trilog beteiligten Institutionen haben sich nach dem Sommer ein intensives Arbeitsprogramm auferlegt. Am 5. Oktober findet der erste inhaltliche Trilog statt. Vor diesem appelliert die Zivilgesellschaft einschließlich NABU an die Politik. Mehr als 200 Organisationen fordern eine Wiederherstellungsverordnung mit effektiven Zielen für alle Ökosysteme und verweisen auch auf den durch Extremwetterereignisse wie Dürren, Fluten und Waldbränden gezeichneten Sommer.