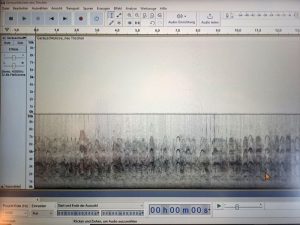Let´s race
Liebe Blogleser*Innen,
der erste Samstag im Mai ist bei vielen Vogelbeobachtern rot im Kalender markiert – denn dann startet eines der größten Vogelbeobachtungs-Events in Deutschland: das Birdrace. Unter Organisation des DDA (Dachverband Deutscher Avifaunisten) finden sich an diesem Tag überall in Deutschland Gruppen zusammen, die einen ganzen Tag lang versuchen möglichst viele Vogelarten zu sichten. Von den gemütlichen Beobachtern, die das gesellige Zusammensein mit Vogelbeobachtung verbinden, zu denen, die das Birdrace als Wettkampfveranstaltung verstehen und alles herausholen was geht – jeder ist willkommen. Und so erfreut sich das Birdrace einer zunehmenden Teilnehmerzahl.
Bei so einer Veranstaltung darf Trischen natürlich nicht fehlen und so beschloss auch ich an den Start zu gehen. Leider lief nicht alles so wie geplant. Als mein Wecker um halb fünf nach einer unruhigen Nacht klingelte, merkte ich spätestens dann, dass etwas so gar nicht stimmte. Ich versuchte es trotzdem, schließlich war ja Birdrace und mein Team zählte auf mich. Also quälte ich mich aus dem Bett, kochte eine Kanne Tee (mit Tee ist immer alles besser) und entschied – wieder ins Bett zu gehen. Alles drehte sich und mir war übel. Anscheinend hatte ich irgendetwas im Essen am Vortag nicht vertragen – 1,5h später sah die Welt aber ein bisschen besser aus.
Ich wagte mich also hinaus und konnte starten, endlich! Die erste Vogelart, die ich sichtete: eine Ringeltaube. Kein schlechter Start für Trischen. Auf dem Festland häufig anzutreffen, schaut sie hier nur gelegentlich vorbei. Ein Blick zum Holzstapel unter die Hütte: die ersten Gartengrasmücken des Jahres. Ein Schwenk mit dem Spektiv über das Watt. Oh oh, Spektiv-Schwenken bei Übelkeit ist nicht besonders förderlich für den Magen. Aber immerhin die ersten Trauerseeschwalben und ein großer Trupp Zwergmöwen. Ich entschied, dass Spektiv-Schwenken erst einmal sein zu lassen und zur Südspitze zu laufen. Und ich hatte Glück: Die dort rastende Trauerente war kooperativ – wieder eine Art mehr auf meiner Liste. Unterwegs „sammelte“ ich auch gleich noch den Steinschmätzer ein. Also wieder zurück zur Hütte. Einen Blick auf den Holzstapel, sehr viel Spektiv-Geschwenke über das immer näher kommende Wasser und zwischendurch immer wieder einen Blick auf das Lockgebüsch und über die Insel. Währenddessen bekam ich immer wieder Nachrichten über tolle Sichtungen von meinem Team, das in Leipzig unterwegs war. Normalerweise „racen“ wir gemeinsam, aber dieses Jahr hat es durch meinen Trischen-Aufenthalt nicht geklappt. Daher mussten wir die seit Corona eingeführte flexible Team-Variante (Teammitglieder starten getrennt) wählen.
Leider setzte sich der vielversprechende Start nicht allzu lange fort. Gegen Mittag nahmen die Neu-Sichtungen rapide ab – was aber auch an meinem kränkelnden Gesundheitszustand gelegen haben könnte. Nach einem kleinen Mittagsschläfchen auf der Bank im Windschatten der Hütte – ohne Pause ging es an dem Tag nicht, aber ich wollte wenigstens keinen „Pieps“ verpassen – kam dann aber doch noch mein kleines persönliches Highlight vorbei: ein Wendehals. Er verweilte kurz im Lockgebüsch, lies sich ausgiebig fotografieren und flitze dann wieder davon: ein Topmodel in Eile. Auch sehr schön waren die ersten Mauersegler, die pünktlich zum Birdrace am Nachmittag vorbeikamen: was für ein Timing!

Wendehals
Nach 11 Stunden mehr oder minder intensiven Beobachtens (und eigentlich viel zu früh) war ich gesundheitlich so geschafft, dass ich leider abbrechen musste. Somit war dies mein sowohl von der Zeit als auch von der zurückgelegten Strecke kürzestes Birdrace. Normalerweise legen wir mindesten 80km mit dem Rad zurück, an diesem Birdrace waren es max. 5km zu Fuß. Den Rest der Zeit verbrachte ich entspannt an der Hütte oder auf dem Turm.
Alles in allem hat das Birdrace wieder sehr viel Spaß gebracht und ich bin sehr froh mitgemacht zu haben. Vielleicht sind sie nächstes Jahr ja auch dabei?
Ihre (wieder gesunde) Melanie Theel